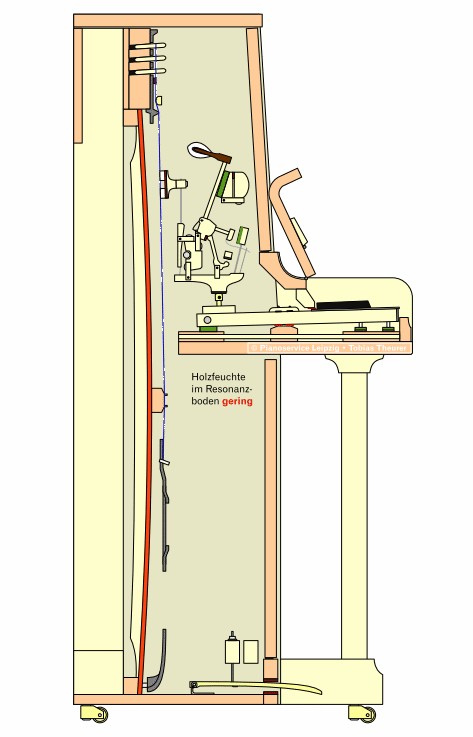Warum verstimmt sich ein Klavier oder Flügel, wenn sich die Luftfeuchtigkeit ändert?
Die Erklärung hierzu muss etwas länger ausfallen, wenn sie einigermaßen schlüssig sein soll. Es geht darum, wie die relative Luftfeuchte, die man auf einem zuverlässigen Digital- oder Haar-Hygrometer ablesen kann, am Standort eines Klaviers oder Flügels dessen Stimmung beeinflusst. Große Schwankungen der Luftfeuchte sind nämlich nach Möglichkeit zu vermeiden, da das Instrument darauf mit Ver-Stimmung reagiert (und bei extremer Trockenheit oder Feuchte sogar beschädigt wird).
Der Resonanzboden aus Massivholz
Die klassische Bauweise von Klavieren und Flügeln mit massivem Fichtenholz-Resonanzboden ist nach wie vor Stand der Technik. (Materialien wie Sperrholz oder carbonfaserverstärkter Kunststoff haben sich bisher nicht durchgesetzt.) Der hölzerne Resonanzboden ist leicht gewölbt, und die zahlreichen Saiten sind nicht nur ihrer Länge nach gespannt, sondern werden durch ihre Aufhängung an der gusseisernen Platte (= Rahmen) gleichzeitig gegen den Steg und damit gegen die Wölbung des Resonanzbodens gedrückt. Deshalb verläuft eine Saite bei einem intakten Klavier oder Flügel auch nicht vollkommen gerade, sondern wird am Steg um mehrere Millimeter ausgelenkt.
In dieser schematischen Schnittzeichnung ist ein Klavier abwechselnd (und leicht übertrieben) bei zwei verschiedenen Holzfeuchten dargestellt. Farblich hervorgehoben sind der gewölbte Resonanzboden und die Saitenebene. Flügel sind sehr ähnlich aufgebaut, nur muss man sich dabei die akustische Anlage um 90° nach links gedreht, also waagerecht, vorstellen. Was hat nun die Holzfeuchte mit der Luftfeuchte zu tun? Grundsätzlich gilt: Holz, ein hygroskopisches Material, reagiert in seinem Feuchtegehalt auf die Umgebungsbedingungen. Bei einer steigenden relativen Luftfeuchte nimmt es Wasser auf und quillt dabei auf – die Holzfasern werden sozusagen dicker. Ein Holzbrett etwa nimmt dabei, bezogen auf seine Faserrichtung, in Breite und Dicke zu (in der Länge hingegen fast gar nicht). Bei sinkender relativer Luftfeuchte geschieht das Gegenteil; das Holz schwindet. Diese Reaktion findet selbst bei schnellen Änderungen der relativen Luftfeuchte nicht sofort statt, sondern allmählich im Verlauf mehrerer Tage oder sogar Wochen. Das genaue Quell- und Schwindmaß hängt von der Holzart ab. Etwaige Oberflächenversiegelungen (Lacke, Kunststoffbeschichtungen usw.) verzögern und verlangsamen die Wasseraufnahme und -abgabe; verhindern können sie sie nicht. Die Dicke eines Holzteils wirkt sich ebenfalls darauf aus, wie schnell seine Größenänderung abläuft.
Holz quillt und schwindet – besonders der Resonanzboden
Bezogen auf ihre Größe quellen und schwinden kleine und große Holzteile der gleichen Holzart in gleichem Maße, nämlich prozentual, also im jeweils gleichen Verhältnis zu ihrer Größe. Absolut gesehen können sich deshalb sehr unterschiedliche Größenänderungen ergeben: So quellen oder schwinden kleine Teile in ihrer Breite und Dicke nur wenig, große hingegen umso deutlicher. Der Resonanzboden eines klassischen Klaviers oder Flügels ist ein ausgesprochen großes Massivholzteil: eine meist 7–10 mm dicke Tafel mit einer Fläche von rund 1–2 m², je nach Größe des Instruments. In nicht eingebautem Zustand (und vor der Berippung des Bodens) kann eine feuchtigkeitsbedingte Größenänderung im Zentimeterbereich liegen. Ins Instrument eingebaut kann sich ein Resonanzboden nicht einfach in seiner Breite bzw. Fläche ausdehnen. Da er aber gewölbt ist, besteht sein Ausweg in eben dieser Wölbung: Quillt der Boden auf, nimmt die Wölbung zu. Schwindet der Boden, geht auch die Wölbung zurück. Da die Saiten über den Steg mit dem Resonanzboden verbunden sind (sonst könnte man ein Klavier kaum hören), wirkt sich die Stärke der Wölbung auch auf die Zugkraft der Saiten aus. Je stärker die Wölbung die Saiten aus ihrem geraden Verlauf auslenkt, also herausdrückt, desto stärker werden die Saiten gespannt, und somit nimmt auch die jeweilige Tonhöhe zu. Und somit gilt: Bei steigender Luftfeuchte steigt auch die Tonhöhe des Instruments, und bei sinkender Luftfeuchte sinkt sie entsprechend.
Ist diese Tonhöhenänderung hörbar?
Das hängt natürlich vom Ausmaß der Feuchteänderung ab. Da sich die verschiedenen Saiten eines Klaviers oder Flügels in unterschiedlichem Maße verstimmen (nämlich in der Mitte des Instruments stärker als am Rand, also bei den ganz hohen und tiefen Tönen, und blanke Stahlsaiten mehr als die mit Kupfer umsponnenen Basssaiten), wird die Verstimmung normalerweise zuerst hörbar, wenn bestimmte Töne gleichzeitig erklingen. Oktaven und Quinten sind hier berüchtigte Intervalle, aber grundsätzlich kann jeder Zusammenklang verstimmt klingen. Außerdem werden die meisten Töne von mehreren Saiten gleichzeitig erzeugt – sobald diese sich unterschiedlich verstimmen, jault und jammert bereits ein einzelner angeschlagener Ton.
Wie stark darf denn die Luftfeuchte schwanken?
Bedeutsam sind vor allem die längerfristigen, jahreszeitlich bedingten Raumklimaunterschiede: Klavierbauer empfehlen oft einen Bereich von etwa 40–60 % für die relative Luftfeuchte. Häufig kommt es jedoch vor, dass die Raumluft während der Heizperiode noch stärker austrocknet, und im Sommer sind auch schon wesentlich höhere Werte vorgekommen. Die meisten Flügel und Klaviere verstimmen sich selbst innerhalb dieser empfohlenen Grenzwerte schon deutlich, und vor allem ältere Instrumente können bei Werten unter 40% auch leicht Risse in Resonanzboden und/oder Stimmstock bekommen. Besonders letzteres ist ein Schaden, den es dringend zu vermeiden gilt, denn dann halten manche Töne die Stimmung gar nicht mehr, sondern sacken gnadenlos ab. Zu feuchte Luft kann wiederum bewirken, dass das Spielwerk schwergängig wird oder auch Stockflecken im Instrument entstehen. In lahrelang im feuchten Keller gelagerten Klavieren können auch Saiten und andere Metallteile rosten. Wie ein Klavier oder Flügel vor solchen Einflüssen geschützt werden kann, soll ein weiterer Artikel beleuchten.
Bis dahin erstmal fröhliches Musizieren!